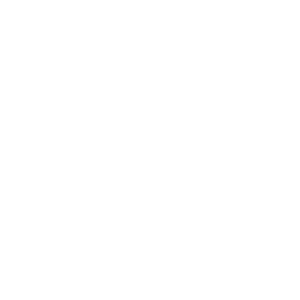Eine Plattform, ein Netzwerk, ein Archiv, und im Mittelpunkt die Übersetzung von Texten: Das ist die Edition Bahia. Im Interview stellen sich Clara Sondermann, Karl Clemens Kübler und Peter Wolff aus dem Gründerteam vor.
Was ist euer Wunsch für die Edition Bahia?
Karl Clemens: Unser Projekt ist ein Webportal, auf dem Übersetzer übersetzte Texte auf Deutsch vorstellen können, um neuen Autoren aus der ganzen Welt im deutschsprachigen Raum ein zentrales Medium zu geben und ihre Texte bekannt zu machen. Bahia ist eine Website, die zum Lesen einlädt. Auszüge aus Romanen, kurze Formen und Essays sollen kurz von den Übersetzern vorgestellt und sozusagen als Promotion für den oder die noch unbekannte AutorIn zugänglich gemacht werden. So sollen interessierte Leser, Übersetzer, Autoren und im besten Fall Verlage an einem schönen Ort im Internet zusammengebracht werden. Bahia soll einen Raum schaffen, in dem Übersetzung als eigene Kunstform wahrgenommen wird.
Das heißt, es gibt so einen Raum bisher noch nicht?
Clara: Es gibt so viele Übersetzungen, die nicht gesehen werden. An denen lange gearbeitet wurde, mitunter auch im Rahmen von Werkstätten. Es ist nicht leicht, diese Texte als noch nicht etablierte Übersetzerin an Verlage zu vermitteln. Programme vom Deutschen Übersetzerfonds helfen dabei sehr. Dennoch ist es so: Wenn das so genannte „Alleinstellungsmerkmal“ eines Textes in einer Mail an die von Einsendungen überfluteten Lektorinnen nicht binnen weniger Minuten ausgemacht werden kann ist, besteht das Risiko, dass etwas Gutes in der Versenkung verschwindet. Ich möchte weder jammern noch verallgemeinern; ganz im Gegenteil habe ich gleich viel Verständnis für beide Seiten und könnte viele Gegenbeispiele anführen. Doch warum nicht einen dritten Raum schaffen, der dieser Marktspannung nicht ausgetzt ist. Es gibt sehr viel zwischen Suhrkamp-Übersetzerin ohne Nebenjobs und dem Übersetzer, der ein halbes Jahr lang ein erstes Gedicht übersetzt (und auch von den beiden möchten wir natürlich Einsendungen!).
Natürlich sind wir uns auch der Tatsache bewusst, dem unterbezahlten Übersetzen von Literatur damit nichts entgegensetzen zu können. Es ist natürlich prekär, doch wenn schon so viel Arbeit in einer Übersetzung steckt, die meist auch nicht bezahlt wurde, verdienen Text und Übersetzer doch Sichtbarkeit mit der Aussicht, am Ende von den richtigen Menschen gefunden zu werden.
Es gibt bei Bahia auch einen festen Bildteil. Wie fügt sich dieser in die Idee ein?
Peter: Was ich generell mit den Fotobeiträgen erreichen will, ist derselbe Austausch. Da man als Fotograf natürlich keinen Übersetzer braucht, könnte die Übersetzung darin liegen, dass der Fotograf nicht in seinem Umfeld ist, sondern im Ausland. Kristin ist ja z.B. Deutsche und fotografiert in Rio.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Ganze im Internet stattfinden zu lassen?
Karl Clemens: Peter Wolff und ich hatten vor längerem die Idee, gemeinsam eine Publikation zu machen. Er ist Fotograf und ich mache so Sachen mit Text. Irgendwann kamen wir darauf, dass es eigentlich schon genug Magazine gibt, die schön aussehen und auch irgendwie gute Texte bieten. Seit 2015 etwa beschäftige ich mich intensiver mit dem Thema Übersetzung und wollte dem seither eigenes Gewicht geben. Zu uns stießen dann Clara und Alex und wir kamen übereins, dass wir unseren Raum lieber im Internet aufbauen wollen.
Clara: Ich finde, es kann nicht genug schöne Magazine geben. Aber dass Bahia eine Website ist, macht es einfacher, mehr Beiträge zusammenzubringen. Und uns interessiert natürlich auch, was andere machen! Bei Treffen von Übersetzern kriegt man das schon mit, aber das ist uns zu wenig. Wir möchten mitbekommen können, woran die anderen arbeiten.
Gibt es schon ähnliche Projekte in anderen Ländern, plant ihr Kooperationen?
Karl Clemens: So weit sind wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir sind in jedem Fall offen für Kooperation.
Auf bahiabahia.de ist am 22. Juli das erste Material online gegangen: Eine Übersetzung von Max Czollek, der Gedichte von Adi Keissar aus dem Hebräischen übertragen hat, ein Fotobeitrag aus Rio de Janeiro von Kristin Bethge sowie die Dokumentation eines Übersetzungsprozesses zwischen Elisabeth Bauer und Nikita Safonov.
Leben, während sich die Leichen stapeln

Überleben ist in Ciudad Juárez eine Frage des Zufalls. Die Stadt hat eine der höchsten Kriminalitätsraten in ganz Mexiko und genießt aufgrund einer seit Jahren andauernden Mordserie an Frauen traurige Berühmtheit. Roberto Bolaño hat seinen Roman „2666“ um dieses Thema herum aufgebaut. Jetzt ist ein Thriller erschienen, der sich ganz dem Sterben in Ciudad Juárez widmet.
Sam Hawken zeichnet in „Die toten Frauen von Juárez“ das Bild einer Stadt, die im Strudel der Gewalt versinkt, sich aber noch einen letzten Funken Menschlichkeit bewahrt. Ein beunruhigender Tatsachen-Thriller, der durch schonungslose Brutalität und bittere Wahrheiten aufrüttelt. Im Gespräch mit The Daily Frown erklärt Sam Hawken, wie sein Roman entstanden ist, warum er die Form des Thrillers gewählt hat – und was er vom Boxsport hält.
Einer der Charaktere in „Die toten Frauen von Juárez“ erinnerte mich an den Boxlehrer, den Clint Eastwood in dem Film „Million Dollar Baby“ verkörperte: Eine fast väterliche Figur, über die Kelly, der gescheiterte Boxer, wieder ins Leben zurückfindet. Was verbinden Sie persönlich mit dem Boxsport?
Meiner Meinung nach ist Boxen eine aussterbende Sportart. In den USA hatte das Boxen eine Zeitlang den Stellenwert von Baseball oder Football: Jeder wusste über die Kämpfer Bescheid, kannte sich mit den Regeln aus und konnte mitreden. Heute stehen eher diverse Kampfsportarten im Mittelpunkt, was ich schade finde. „Die toten Frauen von Juárez” war sogar ursprünglich als eine Art Krimi noir über das Boxen angelegt, um diese ganze vergessene Geschichte wieder aufzunehmen. Dazu ist es zwar nicht gekommen, aber eine gewisse düstere Romantik ist geblieben: Kelly ist, so wie sein Sport, ein aus der Zeit Gefallener.
Das Ciudad Juárez aus ihrem Roman ist ein desolater Ort voller Chaos und Gewalt. Auf der anderen Seite steht die fast zärtliche Liebesgeschichte zwischen Kelly und Paloma, die auf brutale Weise endet. Hat dieser scharfe Kontrast Ihr Schreiben beflügelt?
Beziehungen machen eine Geschichte erst interessant. Es liegt mir nicht, mich beim Schreiben nur auf das Vorantreiben der Handlung zu konzentrieren und die Entwicklung der Figuren außer Acht zu lassen. Kelly wäre eine weitaus weniger fesselnde Figur, wenn diese Liebesgschichte nicht wäre. Er verkäme mit seinem Selbsthass und seinen Drogengeschichten zur Karikatur – und wer möchte schon sowas lesen? Der Roman würde zwar ebensogut ohne die emotionalen Handlungsstränge funktionieren, aber er wäre doch ein total anderer. Ich wollte nicht nur ein fesselndes Buch schreiben (was mir hoffentlich gelungen ist!), sondern dem Leser auch eine Gelegenheit geben, die Figuren an sich heranzulassen. Ciudad Juárez ist zwar eine von Gewalt geprägte Stadt, aber die Leute dort lachen, lieben und leiden wie in jeder anderen Stadt auch. Die Geschichte von Kelly und Paloma erinnert einen daran, dass es auch diese Seite noch gibt.
Prügel, Mord, Vergewaltigung: Ab einem bestimmten Punkt hat man bei Ihrem Roman das Gefühl, dass es wirklich jedem an den Kragen geht. Aber die Mujeres Sin Voces, eine Frauenorganisation, arbeitet beharrlich gegen die Gewalt an. Verkörpern sie vielleicht die letzte Hoffnung auf einen Rest Menschlichkeit in dieser von Gott verlassenen Stadt?
Nun, Ciudad Juárez mag eine unglaublich gewalttätige Stadt sein – andererseits ist sie aber auch für viele tatsächlich ein Symbol der Hoffnung: Menschen aus ganz Mexiko strömen hierher auf der Suche nach Arbeit! Und während sich die Leichen stapeln, versuchen diese Menschen ihr Leben so gut wie möglich auf die Reihe zu kriegen. Juárez ist ja alles andere als eine Geisterstadt, sie pulsiert vor Leben. Und trotz der omnipräsenten Gefahr suchen immer noch viele hier ihr Glück.
Die Mujeres Sin Voces in meinem Buch basieren auf zwei tatsächlich existierenden Organisationen aus der Zeit der Jahrtausendwende. Inzwischen gibt es noch viel mehr Gruppen, die für Gerechtigkeit in Juárez eintreten. Eine ihrer Aktivistinnen, Norma Esther Andrade von Nuestras Hijas de Regreso a Casa, wurde dafür erschossen und erstochen. Diese Arbeit aufrechtzuerhalten verlangt ein großes Maß an Ausdauer, wenn man sich dieser Gewalt gegenübersieht. Ich hoffe, dass mein Buch auch nur einen Bruchteil dieses Engagements vermitteln kann.
Ihr Roman schockiert mit seiner äußerst brutalen Gewaltdarstellung, trotzdem muss ich zugeben, dass ich ihn auf eine spannende Art auch unterhaltsam fand. War es für Sie schwer, eine real existierende Situation wie die in Ciudad Juárez in einem Thriller unterzubringen, der seine Leser auch unterhalten soll?
Bis zu einem bestimmten Punkt ist es sehr leicht, eine spannende Geschichte aus Ciudad Juárez zu erzählen – man muss ja nichts erfinden. Eine Story, in der versucht wird, diese Gewalt aufzuklären, schreibt sich da wie von selbst. Alles, was ich über die Stadt erfahren habe, machte die Geschichte umso dichter, weil ich so viele Details einbauen konnte. Tatsächlich war ich erstaunt, wie gut der Roman dann bei den Lesern angekommen ist. Es ist ja schon ein ganz schön düstere Geschichte, selbst die wenigen schönen Stellen stehen ganz im Schatten der Gewalt. Ob es überhaupt eine andere Möglichkeit gibt, darüber zu schreiben – ich weiß es nicht.
Wäre es für Sie also nicht denkbar gewesen, beispielsweise eine Reportage oder ein politisches Sachbuch zu den Frauenmorden in Cuidad Juárez zu schreiben?
Das gibt es schon: „The Daughters of Juarez: A True Story of Serial Murder South of the Border“ von Teresa Rodriguez, Diana Montané und Lisa Pulitzer. Jeder, der sich auch nur im Ansatz für die Lage in Juárez interessiert, sollte dieses Buch lesen. Selbst wenn ich doppelt so viel für „Die toten Frauen von Juárez“ recherchiert hätte, ich hätte nie zustandegebracht, was Teresa Rodriguez mit ihrem Buch schafft.
Die perfektionierte Aristotelik

William Faulkners Reiseschreibmaschine (Foto: Gary Bridgman)
Im Handbuch des Nonlinearen Erzählens berichtet Tobias Hülswitt über seine Erfahrungen mit dem Korsakow-Programm, das die Produktion nicht-linear erzählter Filme ermöglicht.
Zum Auftakt der neuen Reihe Literatur bei The Daily Frown, in der Autoren selbst zu Wort kommen sollen, spricht er mit uns über die Evolution des Erzählens und unsere narrativen Gewohnheiten.
Wie bist du eigentlich auf Zygmunt Haupt gekommen? Beim Lesen des Auszugs aus Ein Ring aus Papier habe ich mich plötzlich an ähnliche Leseerlebnisse erinnert, die ich damit in Verbindung bringe. Zum Beispiel Noch einmal für Thukydides von Peter Handke. Aber je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Beispiele fallen einem ein, da würde man dann ganz schnell auch bei Faulkner und Kafka oder sowieso Alfred Döblin landen, der ja als Mediziner seine Dissertation über die „Korsakoffsche Psychose“ geschrieben hat.
Die Verbindung zu Kafka sehe ich eigentlich nicht. Wo siehst du sie genau?
Ich dachte an die Editionslage vom Prozess, dessen Kapitelreihenfolge ja nicht genau festlegbar ist, was kürzlich in einer Hörspielbearbeitung so übernommen wurde, dass man pro Kapitel eine CD aufgenommen hat und diese in beliebiger Folge hören kann. Diese Idee fand ich sehr schön. Bei dem zitierten Buch von Peter Handke gibt es diese Beobachtungsprosa, die auf oft nur zwei Seiten etwa eine Schneeflocke oder einen Baum beschreibt. So hat er das aber davor und danach leider nicht mehr gemacht.
Ja, richtig, die Kapitelreihenfolge vom Prozess stand ursprünglich nicht fest. Das technische lineare Medium Buch hat zur Festlegung gezwungen. Nun kommt das technisch nonlineare digitale Medium und ermöglicht die Darstellung in der beabsichtigten nichtlinearen Form. Das ist ein wunderschönes Beispiel für das, was ich meine, wenn ich sage, dank des Computers können wir die Zettel des Zettelkastens in die Luft werfen und durch die Zettelwolke spazieren, ohne das ein Zettel verloren geht. Das digitale Medium ist die Bindung der Wolke.
Zu Thukydides: Genau, Autoren machen das einmal, dann wenden sie sich wieder den marktgängigen Formen zu, weil diese Beobachtungen nicht belohnt werden. Man bringt ihnen in unserer Kultur Respekt entgegen und versteht sie als Ausweis des Könnens des Autors, der Autorin, aber keine monetäre Wertschätzung. Das gleiche trifft ja auch für die Lyrik zu. Man verstehe mich nicht falsch, ich will nicht lamentieren! Mich interessiert daran, was es über die Denkgewohnheiten und Denkmöglichkeiten unserer Gesellschaft aussagt. Von Peter Handke habe ich nur einmal Die Angst des Tormanns beim Elfmeter angefangen. Da ist ja schon der Titel verkehrt, denn der Tormann hat beim Elfmeter keine Angst, sondern nur der Schütze. Das Buch fand ich dann allerdings spitze, bis zu der Stelle, an der klar wird, dass die Hauptfigur jemanden umgebracht hat. Da habe ich das Buch direkt in die Ecke gepfeffert: Aha, doch nur ein Trick, um einem wieder etwas Unerhörtes unterzujubeln, eine Kuriosität. Besonders fies, wenn es so gut begonnen hat. So etwas findet man bei Haupt nicht. Da wird nichts untergejubelt, keine literarischen Überwältigungsstrategien werden gefahren. Und doch gibt es ein Feuerwerk, ein Feuerwerk an Dingen, an erinnerten Details, an vergehender Welt. Das ist viel berührender als alle schönen Stories aller Zeiten zusammen.
Der Aufbau und der Rhythmus der Erzählung machten mir Spaß, aber gleichzeitig wurde ich mißtrauisch. Das ist nicht das Leben, dachte ich. Das ist nicht die Wahrheit. Das Leben kann nicht eine fortlaufende Kette schön komponierter Phrasen sein, das wäre zu einfach und sicher auch zu langweilig, das Leben ist nicht eine Reihe von Ursachen und Folgen, eine Serie von Prämissen, aus denen hübsche runde Schlußfolgerungen entstehen, es ist auch kein Material, das einer bestimmten Funktion dient und auch nicht eine Art Monogramm.
(Zygmunt Haupt: Ein Ring aus Papier)
Auf Haupt bin ich durch Andrzej Stasiuk gestoßen, wenn ich mich recht erinnere, oder zufällig, ich weiß es nicht mehr.
Vielleicht ist ja das non-lineare Erzählen sogar so alt wie das Erzählen selbst, wenn man etwa an Laurence Sterne denkt.
So ist es. Aristoteles disst es bereits in seiner Poetik: Episoden und Geschichten, die sich unzusammenhängend um einen Helden organisieren, zum Beispiel Herakles, hält für das Schlechteste, was Erzählung hervorbringen kann. HBO mit seinen Serien wäre bei ihm durchgefallen.
Du sagst aber doch in deinem Buch, alle Drehbuchautoren in Hollywood seien knallharte Aristoteliker. Aber da muss man wieder zwischen Erzählen im Kinofilm und seriellem Erzählen unterscheiden, oder?
Klar, serielles Erzählen ist TV, Sender wie HBO. Es kommt darauf an, wo man die Kritik ansetzt. Arbeiten Serien auch mit den Techniken des Fesselns, Bannens, Mitreißens? Natürlich. Arbeiten Sie mit Figuren, die Menschen repräsentieren sollen? Klar. Bauen Sie Illusion auf, ohne ihre Konstruktion zu zeigen? Selbstverständlich. Wenn man also Fundamentalkritik betreiben will, könnte man sie ideologisch auseinandernehmen. Aber auf die gleiche Weise könnte man den Ulysses auseinandernehmen. Allein schon wegen dem Problem der Repräsentanz. Aber trotzdem bieten Serien oft ein anderes Bild der Realität, ein zugleich verwobeneres, was die Handlung betrifft, und entzerrteres, was das Vergehen der Zeit betrifft. Das ist der technischen Grundlage geschuldet. Der Film kommt in seinen 90 oder 120 Minuten, wenn er linear erzählt sein will, zwangsläufig auf die perfektionierte Aristotelik zurück.
Die Fabel des Stücks ist nicht schon dann – wie eine einige meinen – eine Einheit, wenn sie sich um einen einzigen Helden dreht. Denn diesem einen stößt undendlich vieles zu, woraus keinerlei Einheit hervorgeht. So fürht der eine auch vielerlei Handlungen aus, ohne daß sich daraus eine einheitliche Handlung ergibt. Daher haben offenbar alle die Dichter ihre Sache verkehrt gemacht, die eine Herakleïs, eine Theseïs und derlei Werke gedichtet haben.
(Aristoteles: Poetik)
Die Serie muss das nicht, sie kann sich bestimmter Elemente der Hollywoodlehre bedienen, ist ihr aber nicht sklavisch unterworfen. Man muss bei all dem natürlich sagen: Die Leute scheinen das lineare Kino, zum Beispiel, ja aber zu mögen! Sie gehen hin und konsumieren es wie wild. Die können ja nicht alle dumm sein. Und es setzt sich eben das durch, was gewollt wird. Und das stimmt zu Teil. Andererseits wissen wir, dass nicht nur die Konsumentenseite das Angebot bestimmt. Wenn wir heute beispielsweise ein vollelektrisches Auto kaufen wollen, das 200 km/h fahren kann – schwierig, weil es kaum im Angebot sein wird. Und weil die Infrastruktur weitgehend auf Verbrennungsmotoren ausgelegt ist, die wir kaufen sollen, damit wir die fossilen Brennstoffe konsumieren, die die Anbieter uns verkaufen wollen. Bei der Erzählung ist natürlich schwieriger zu bestimmen, auf welche Weise die Produzenten uns eine wirtschaftliche Infrastruktur aufzwingen. Aber der Autor Christian Salmon zeigt zumindest, wie das Storytelling auf vielfache Weise von Politik und Wirtschaft genutzt wird. Auch wenn sich das sicherlich zum allergrößten Teil unbewusst abspielt, profitieren sehr viele Leute von unseren simplizistischen narrativen Gewohnheiten.
Obwohl, der extreme Erfolg dieser Serien hätte Aristoteles vermutlich umgestimmt, denn man muss annehmen, dass er sein Urteil ausgehend vom Applaus im Theater entwickelte: Seine Poetik ist eine Überlegung, was die Gründe für den meisten Applaus sein könnten. Und die Gründe, die er findet, erhebt er zur Norm. Man könnte grob vereinfachend sagen, das nonlineare Erzählen wurde im Laufe der Evolution des Erzählens zurückgedrängt. Im Filmischen noch radikaler als in der Literatur, wo es nie ganz auszumerzen war, weil der Roman an sich näher am Denken ist und das Denken große Reserven des Nichtlinearen enthält. Im Moment, nicht zuletzt durch die Emergenz des Computers, erleben wir eine Renaissance des Nichtlinearen. Ich bin allerdings gar nicht dafür, dass nun das Lineare zurückgedrängt werden soll. Ich votiere für eine Geschichtenvielfalt, story diversity, auch wenn mir selbst die nichtlinearen Formen näher sind. Eine Kultur, die über viele Formen des Erzählens verfügt, verfügt über viele Denkweisen und ist eher in der Lage, Lösungen für drängende Probleme zu finden. Angesichts der Klimakatastrophe ist das notwendiger denn je. Ich glaube allerdings, dass wir gerade jetzt mehr nichtlineares Erzählen brauchen, weil wir durch lineare narrative Strukturen, also grob gesagt durch Stories, beständig Denkmuster reproduzieren und verfestigen, die mit zu vielen Simplifizierungen und Reduktionen arbeiten, um unserem Denken zu mehr Komplexität zu verhelfen, antagonistisches und konfliktorientiertes Denken aufzubrechen und den Menschen wirklich weiterzubringen. Wir müssen heute Anteile unserer Natur stimulieren, die uns helfen, diejenigen aggressiven Anteile zu dimmen, die uns bisher als Spezies so erfolgreich gemacht haben.
Filmisches Erzählen, also Schnitt- und Montagetechniken findet man ja gerade bei Berlin Alexanderplatz durchgehend als erzählerisches Mittel angewendet. Der Roman ist heute zwar ein Klassiker, gilt aber immer noch als „schwierig“, „experimentell“ oder Avantgarde-Literatur. Warum setzt sich das geradeheraus Erzählte immer noch besser durch?
Weil es unsere Sinne sozusagen genau an der Stelle krault, an der sie am allerliebsten gekrault werden. Sie werden dabei nicht überfordert, und es wird ihnen alles genauso vorgesetzt, wie sie am besten verarbeiten können: niedrigkomplex, reduziert, einer höheren Ordnung – der Dramaturgie – gehorchend. Dass alles, was in der Erzählung geschieht, mag es noch so grausam sein, in der höheren Ordnung der Dramaturgie aufgehoben ist, beruhigt uns zudem enorm. Denn genau das teilt uns jede lineare Erzählung permanent mit: Keine Angst, hinter all dem, was du hier siehst, steckt ein Plan. Das ist natürlich eine metaphysische Beruhigungspille, also pure Religion.
Besonders interessant fand ich die Aussagen von mehreren Personen in deinem Buch, die ihr deterministisch durchgeplantes Leben zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr ertragen haben. Das ist doch genau die Anknüpfung zwischen Literatur und Leben, wo zum Beispiel Döblin das Chaos abbildet, anstatt durch Erzählen eine künstliche Kausalität herzustellen. Er vermischt Schlager, Straßenpalaver und inneren Monolog derartig, dass es ein Traum ist! Den Wallenstein dagegen finde ich nahezu unlesbar, weil er sprachlich total ausufert und – wahrscheinlich in voller Absicht – den Faden völlig fallen lässt.
Ich behaupte, dass das Bedürfnis nach linearem Leben sich in dem nach linearen Geschichten spiegelt und umgekehrt, dass sie sich gegenseitig anspornen und in einem ewigen Kreislauf bestätigen. Man muss allerdings vorsichtig sein: Ein nichtlineares Leben kann genauso im Sinne des Systems sein, namentlich des neoliberalen, das Menschen ohne feste Bindungen, Traditionen, Verwurzelungen bevorzugt und sich die Hände reibt, wenn Arbeitnehmer Hyperflexibilität entwickeln. Das Nichtlineare darf nicht zum völligen Verlust von Widerständigkeit führen.
Ich würde vorschlagen, so wie alle auf den „großen Wenderoman“ gewartet haben, könnten wir ja nun auf den „großen non-linearen Roman“ warten. Wie stehen die Chancen?
Gut! Ich wette, dass der erste wirklich nichtlineare massenfähige solche Roman innerhalb der nächsten zehn Jahre auf dem Ladentisch liegt.
Tobias Hülswitt wurde 1973 geboren und veröffentlichte mehrere Romane, darunter Dinge bei Licht, Der kleine Herr Mister und Saga. Zusammen mit Florian Thalhofer gründete er das Korsakow Institut für Nonlineare Erzählkultur, dem er bis 2010 angehörte. Im selben Jahr erschien der Band Werden wir ewig leben?: Gespräche über die Zukunft von Mensch und Technologie bei Suhrkamp. Das Handbuch des Nonlinearen Erzählens ist in der Edition Pächterhaus erschienen, hat 112 Seiten und kostet 8 €.