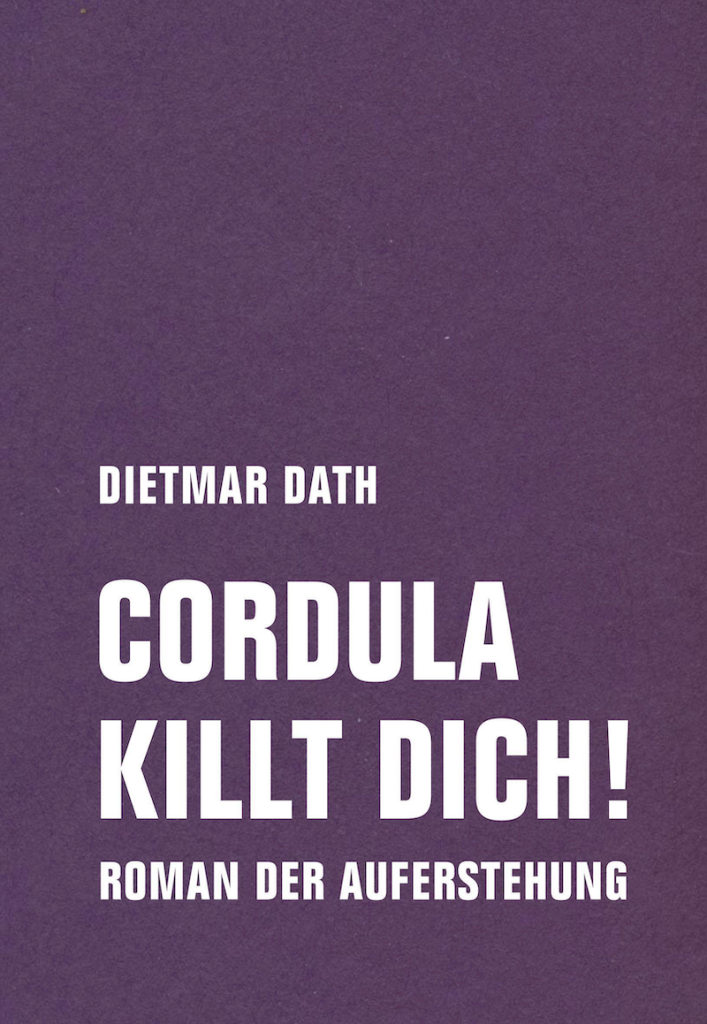
Es ist der Roman, mit dem alles anfing, lange vergriffen, Stoff von Legenden: Jetzt hat der Verbrecher Verlag das Debüt von Dietmar Dath, mit dem 1995 die Verlagsgeschichte begann, wiederveröffentlicht.
Cordula killt dich! Oder: Wir sind doch nicht die Nemesis von jedem Pfeinenheini. Roman der Auferstehung spielt in der damaligen unmittelbaren Gegenwart, dem Jahr 1994, greift aber auch bis tief in die achtziger Jahre zurück. Er erzählt die Geschichte einer Gruppe von jungen Leuten, die in Freiburg leben; eine von ihnen ist die Avantgarde-Komponistin Cordula Späth, die, so der Auftakt, Anlass und Thema des Romans, aus ihrem WG-Fenster fällt und stirbt. Ihr Mitbewohner Dietmar Dath beschließt daraufhin, einen Roman über ihr Leben und die freundschaftlichen Verwicklungen zwischen ihm, Cordula, dem drittem Mitbewohner Wolfgang, außerdem Cordulas Ex-Freundin Katja Benante und viele weitere Personen aus dem Freundeskreis zu schreiben. Er erinnert sich an seine Schulzeit, beschreibt seine ersten journalistischen Versuche. Ständig reflektiert er dabei das Schreiben selbst, schweift in schwer nachzuverfolgende Gedankengänge ab, montiert Briefe, Textdokumente von Dritten ein. Das ist oft lustig, an vielen Stellen aber auch etwas hermetisch.
Ja! Ziemlich kindlich fällst Du ins erste Kapitel. Vertrauensvorschuß kannst Du ja geben.
Die ersten Worte: Immanuel, Immanuel, Immanuel, Immanuel Kant. (T-e-c-h-n-o: Immanuel, bip, Immanuel, bip, Immanuel, bip, Immanuel, bip, Immanuel, bip, Kant, smASSH!)

Dass Cordula killt dich 1995 aber literarisch eine ziemliche Ausnahmeerscheinung gewesen sein muss, steht fest: Dath meidet das lineare Erzählen wie die Pest, baut musiktheoretische Exkurse, Dr.-Mabuse-Obsessionen sowie eine aberwitzige Science-Fiction-Handlung in den Roman ein und folgt auch stilistisch einem ganz eigenen Regelsystem: Da wird gelautmalt, in Unterhaltungen naturalistisch mit „Ähs“, „Öhs“, Stottern und Wortwiederholungen gearbeitet, sogar (und das 1995!) gegendert und die Selbstreflexivität auf immer neue Spitzen getrieben. Und in der Rückschau kann man Cordula killt dich auch als historischen Roman lesen: Die Grunge-Ära der frühen neunziger Jahre ist genauso gut eingefangen wie das Computer-Zeitalter, MS-DOS-Befehle, Texte, die auf Disketten gespeichert werden (unter anderem der vorliegende Roman selbst) und die das Internet vorwegnehmende Usenet-Umgebung, aber auch die gesellschaftspolitischen Umstände, in denen Daths Figuren in den achtziger Jahren zwischen Kaltem Krieg, Sowjet-Propaganda, Trotzkismus und der leidigen südwestdeutschen Provinz aufwachsen, werden deutlich sichtbar.
Ob das weitverzweigte Werk Dietmar Daths, das in den 26 Jahren nach Cordula entstanden ist und allein knapp 30 Romane umfasst, davon zwei für den Deutschen Buchpreis nominiert (Die Abschaffung der Arten 2008, Gentzen oder: Betrunken aufräumen 2021), schon zu erahnen ist, wenn man Cordula killt dich liest? Der hyperrealistische, bis an die Schmerzgrenze scharfgestellte und alles erfassende Erzählstil, der auch Gentzen ausmacht, ist hier jedenfalls schon angelegt, ebenso die Fragilität des Roman-Konstrukts, die sich in diesem jüngsten „Kalkülroman“ äußert. Eine weitere Volte dreht Dath übrigens in einer eigens für die Neuausgabe von Cordula killt dich geschriebenen Erzählung, in der die Figuren des Romans in ihren Autor wegen „feigem Formalismus“ vor Gericht stellen – und den Roman mit seiner eigenen Rezeptionsgeschichte konfrontieren. Das Buch selbst liegt währenddessen auf einem Baumstumpf, bewacht von einem vergilbten Leguan. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Schlussbild.
